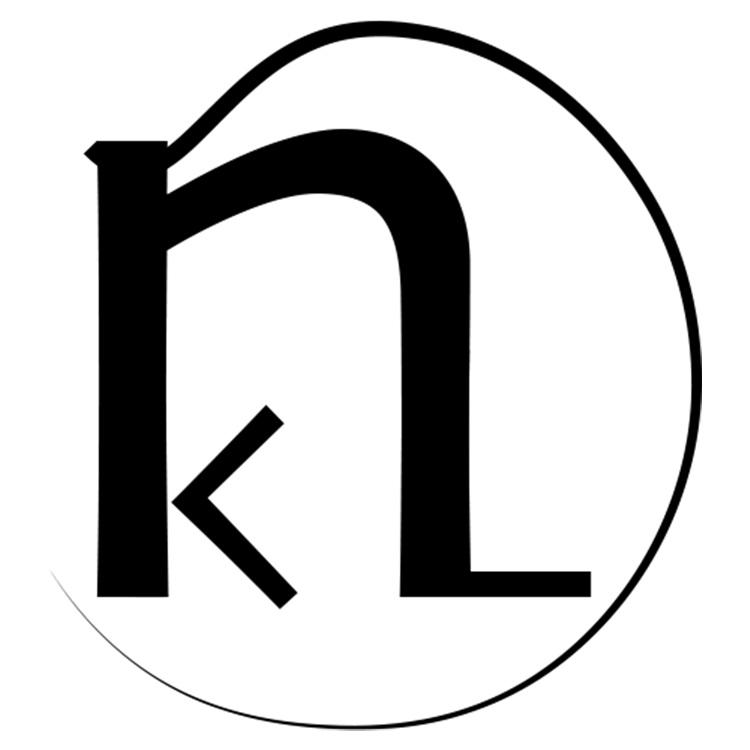Svenja Gräfen stellt in „Freiraum“ dar, wie Wohnumstände das eigene Leben in allen Aspekten prägen und leistet damit einen spannenden Beitrag zur literarischen Erschließung des Themas Wohnungsnot.
Auf über 100 Suchende kommt in Berlin eine Wohnung, fast die Hälfte aller Neueinstellungen junger Menschen sind befristet: begleitet von Erzählungen über eine „faule“ Jugend, die nicht mehr arbeiten will, hat der Siegeszug des Kapitalismus nach 1990 die existenzielle Unsicherheit junger Menschen inzwischen zum Normalzustand erhoben. In diesem Zustand befindet sich auch Vela, Protagonistin des 2019 erschienenen zweiten Romans der Autorin. Trotz intensiven Bemühungen weder in einem passenden Job noch einer passenden Wohnung, bleibt Vela nach dem Abschluss nur die vage Hoffnung, dass irgendwann doch alle was finden – oder nicht?
Wohnprojekt statt Wohnungsmarkt
Gräfens Roman ist dramaturgisch zweigeteilt. Im chronologisch ersten, in Rückblenden erzählten Handlungsstrang lernt Vela ihre spätere Partnerin Maren kennen und zieht mit ihr mangels Alternativen in eine überteuerte, kleine Wohnung in der Stadt. Während Schimmel, Heizungsausfälle und Mieterhöhungen zunehmend die Beziehung belasten, bleibt die Suche nach einer geeigneten Bleibe auch nach anderthalb Jahren erfolglos. Dass die beiden „kein verdammtes Loft“ wollen, nützt ihnen nichts, der unsichtbaren Hand des Wohnungsmarktes sind ihre Berufe nicht einträglich genug. Mit der Gelegenheit, in das Wohnprojekt von Marens Schwester etwas außerhalb der Stadt zu ziehen, erscheint plötzlich ein bisher nicht gesehener, ein alternativer, ein neuer – vielleicht sogar besserer Weg.
Das Leben in der nunmehr achtköpfigen WG samt Kleinkind bildet den zweiten, zentralen Handlungsstrang. Sein Ende schon zu Beginn preisgebend, hat die Darstellung des Stadtlebens ihren Fokus auf der Figurenentwicklung und der impliziten Kritik gesellschaftlicher Verhältnisse. Velas Schicksal im Wohnprojekt ist demgegenüber offen, eine Offenheit, die sich nach anfänglicher Harmonie mit der Zunahme von Konflikten spätestens ab der Hälfte des Buches in eine sehr ergiebige Spannungsquelle verwandelt. Merkwürdige Zufälle, Geheimnisse, Lügen: ausgestattet mit dem Werkzeugkasten eines Horrorfilms – freilich, ohne im klassischen Sinne gruselig zu sein – lässt Gräfen die Situation erzählerisch geschickt unangenehmer werden. Dank eines feinen Auges für Zwischentöne, Körpersprache, Kommunikationsweisen entsteht das nachvollziehbare Bild einer Gemeinschaft, wie sie nicht sein sollte, nicht funktioniert und vor allem: nicht so anders ist, wie die Gesellschaft, dessen Alternative sie zu sein scheint.
Raum für Unsicherheit
Klar wird: wo wohnen und arbeiten dem Markt überlassen werden, wird Unsicherheit produziert und wo Unsicherheit herrscht, entstehen Konflikte. Ein Streit, in dem Vela Maren vorwirft, sie könne nicht so tun, als wäre alles super und Maren Vela, sie könne nicht so tun, als wäre alles scheiße, erscheint vor diesem Hintergrund genauso exemplarisch wie unlösbar. Die Sorgen über die Zukunft, verbunden mit den Nöten der Gegenwart, nehmen für Vela soviel Raum ein, dass es ihr schwerfällt, mit dem akuten Kinderwunsch von Maren umzugehen, ihr fehlt – gedanklich wie tatsächlich – der Freiraum, darüber zu entscheiden. Nachvollziehbar zeigt Gräfen auf diese Weise den Zusammenhang von persönlichen Lebensentscheidungen und der Realität einer Welt, in der nichts sicher ist, nicht die Wohnung, nicht die Arbeit, nicht das Klima, nicht – zwar nicht explizit genannt, doch aktuell nicht mehr wegzudenken – der Frieden.
Obwohl nicht in der Ich-Perspektive geschrieben, ist der Roman sehr nah dran an der Hauptfigur, an ihren Handlungen, Gedanken, Gefühlen. Der Satzbau folgt den Regeln von Velas Gedanken, mal sind es nur Halbsätze, mal Gedankenschnipsel, mal einzelne Wörter. Diese enge Beziehung zur Figur funktioniert grundsätzlich gut, fördert die Authentizität und ermöglicht ein voraussetzungsloses, flüssiges Lesen des Textes. Die Autorin hätte allerdings mehr darauf achten können, dass Vela den Lesenden nicht Offensichtliches „vordenkt“. Als sie z.B. bereits von den Lügen im Hausprojekt erfahren hat, sitzen alle mit einem Gast abends zusammen und wirken harmonisch, gekrönt von einem „Life is beautiful“ von Maren. Obwohl die Lesenden natürlich wissen, warum das absurd ist, erklärt Vela im nächsten Abschnitt, warum es absurd ist. Unabhängig davon, bleibt Vela aber ein gut gezeichneter Charakter, deren Gedanken der Handlung ein ums andere Mal eine fruchtbare Doppelbödigkeit verleihen.
Auf der Suche nach Bleiben
„Vela hat keine andere Idee. Sie weiß nur, so wie jetzt geht’s nicht weiter.“ Es ist der Fixpunkt der Handlung, dass Vela nicht zur Ruhe kommt, aus einer Situation, in der es nicht so bleiben konnte, wie es war, gerät sie in die nächste, die nicht so bleiben kann, wie sie ist. Am Ende lässt Gräfen bewusst offen, wo der Ausweg ist. Der Hoffnung, dass alle auch im jetzigen System irgendwann was finden, gibt sie jedenfalls keinen Nährboden. Zu Recht.
Von Daniel Polzin, 30. Mai 2025
Svenja Gräfen: »Freiraum«. Ullstein fünf, gebunden, S. 304, 20 €.