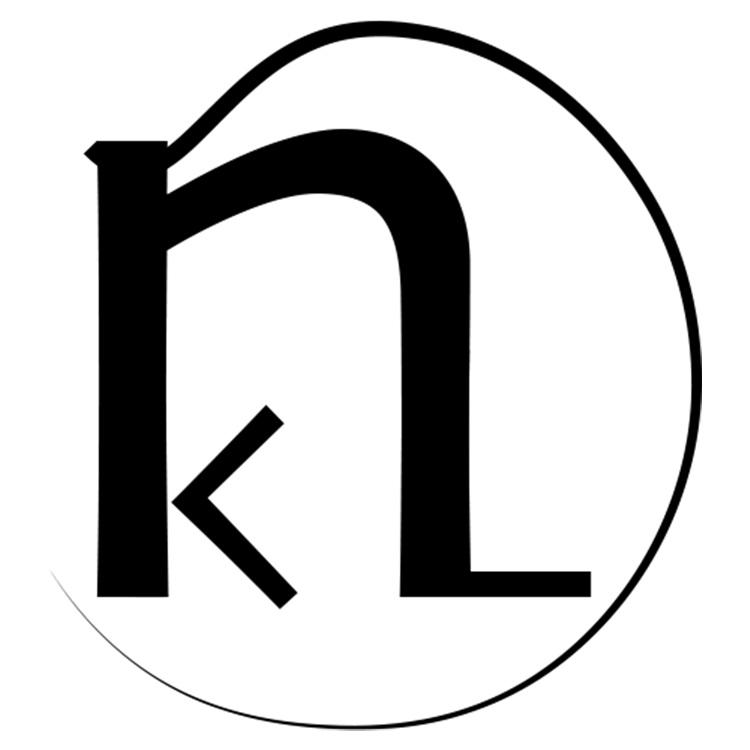Blut spritzt ins Blickfeld. Bevor die Faust gesehen wird, wird sie gespürt. Weitere Schläge prasseln auf den Kopf, die Schultern ein. Ein Ausweichen nach rechts, nur ein kleiner Sprung, und der nächste Schlag verfehlt sein Ziel. Mit einem gewaltsamen Schwenk seines Ellbogens landet sein Nächster jedoch wieder im Rippenkäfig. Als der Körper zusammenbricht, sich reflexartig zusammenkauert, um das Innerste zu schützen, landet ein weiterer Schlag auf dem Rücken und bringt den Körper zu Boden.
„Petro, hör auf! Du bringst das Kind um!“ Zarte Finger krallen sich um den Nacken eines Stiers. Ein einfacher Schwung seiner Schultern reicht, und ihre Mutter wird zur Seite geschleudert. Er dreht sich wieder zu ihr um, die immer noch auf dem Boden liegt. Mit einem Ruck packt er ihre Füße, dreht ihren elfjährigen Körper kopfüber und schüttelt sie in der Luft. „Warum zum Teufel hast du gestohlen? Du musst es nicht!” Ihr zwanzig Kilo leichter Körper wird Zentimeter über dem Boden hin und her gerissen. Der Blick ihres Vaters ist eine schmerzverzerrte Grimasse: „Wir hatten nichts! Du hast alles!“
„Petro! Die Nachbarn! Bitte!“, schrillt es zittrig aus der Ecke. Als ihr Kopf auf dem Marmorboden aufschlägt, wird ihr Gesicht heiß, ihre Sicht schwindet. Das war es jetzt. Wenigstens könnte es jetzt endgültig vorbei sein. Erleichterung flutet ihren Körper.
„Stehlen als Streich! Die deutschen Kinder können sich das leisten, du nicht!“
Petros Faust brennt; die Knöchel schmerzen. „Jetzt werden sie denken, dass wir arm sind, die Krauts mit ihrem Kohl, diese Nazis!“ Seine Schlagader pocht gegen seinen Hals, gegen den Kiefer, der zum Bersten zusammengepresst ist. „Diese Schande! Wieder die dreckigen Einwanderer werden sie sagen – sie! Diese größten Verbrecher von allen!“ Sein Kopf schwirrt; der Geruch von Weihrauch und Alkohol steigt ihm in die Nase, wirft ihn zurück in alten Nebel.
„Ich bringe dich um, gamoto! Weißt du, was du mir angetan hast?“ Ein Schlag trifft sein Schlüsselbein; der nächste kommt scharf von links und zertrümmert sein Jochbein. Zu seiner Linken füllen die agies ikones, die heiligen Ikonen, mit ihrem Weihrauch und Öllampen die dunkle Ecke des engen Raums. Von rechts tritt seine Mutter aus der spärlich von Kerzenlicht erhellten Kochkammer. „Und wo ist dein Stalin nun, huh? Du hattest schon verloren, als er nicht aufgetaucht ist, das weißt du, oder? Ihr seid alles Feiglinge, sowieso!“ Sein Vater kreist vor ihm mit hochgezogenen Schultern im Saloni, der kleinen Wohnstube, die den größten Teil des kleinen Steinhauses ausmacht.
„Die Widerstandskämpfer der ELAS, alles Feiglinge, Babá? Es ist dein König, der den Deal gemacht hat, uns für nichts verkauft hat!“ Durch den Alkoholdampf hindurch verzieht sich sein Mund zu einem schiefen Grinsen: „Der König sorgt für dich, du dummes Kind! Mein Sohn, ein Kommunist! Du hast mich blamiert; du hast uns blamiert!“ Sein Blick ist glasig, seine Lippen trocken, blättern ab. Er schwingt seinen rechten Arm in einem weiten Bogen aus, während er auf ihn zustolpert. Mit einem schnellen Kopfdrehen taucht Petro unter dem nächsten Schlag weg. „Ich bin kein Kommunist! Ich bin, zum tausendsten Mal, ein Demokrat!“
„Alles das gleiche für mich, du angeberisches Stück Scheiße! Du kennst keine Not! Du weißt nicht, was es heißt, ein Mann, ein Patriot zu sein!“
„Bedeutet es, deine Nachbarn zu töten, Babá?“ Das Gesicht seines Vaters verdunkelt sich, ein Funke aus seinen Augen trifft ihn wie ein Blitz. Ein Moment der Unaufmerksamkeit, und sein Oberkörper prallt gegen die Wand, während sich Fäuste in seinen Magen drücken, ihn nach Luft schnappen lassen. Sein Vater ist nicht schwer, aber schnell und stark. „Du verstehst nichts! Das ist es, was wir mit Verrätern tun, wozu ich befohlen bin, was meine Pflicht ist!“ Seine Brust ist gegen die Wand gepresst. Seine Lunge brennt. Seine Stimme kriecht in seinem Hals in einem dünnen
Faden zwischen den Fingern seines Vaters hindurch. „Warum? Weil sie ein Lied gesungen haben? Dieses hier? Ooooh, du armer Bastard, oh Dhumas…“
Schläge prasseln auf sein Gesicht nieder. „Halt den Mund, das ist Gotteslästerung! Du wirst gehängt, wenn du weitermachst, du…“ „Oh, du König von…“ Eine Ader um sein Auge gibt dem Schlag nach, implodiert und hinterlässt einen spritzig purpurnen Fleck unter seiner olivbraunen Haut. Sein Vater hält ihn immer noch im Würgegriff, sein Atem nah, heiß und sauer, seine Augen eine Karte geplatzter Adern, die sich einen Weg in seinen Kopf bohren. Er kann kaum durch den Würgegriff sprechen. „Du mochtest… sie einfach nicht, Babá! Und du wolltest… ihr Land, das ist alles, was es ist! Obwohl du sowieso immer zu betrunken bist..… um es zu beackern…, ha!“
„Ich! Ich bin ein Soldat des Königs, mein Interesse ist das Interesse des Königs!“
„Hör auf, hör auf, Christo, bitte hör auf!“, fleht seine Mutter und wird zur Seite geschmettert. Eine gebeugte Figur, die zurück in die Schatten kehrt; sie weiß es besser, als dazwischenzugehen. Der Griff seines Vaters lockert sich nun ein wenig, als er ihn in die Küche zerrt, vorbei an seiner Mutter, in die Ecke neben dem Herd. Rückwärts taumelnd stolpert er hinter ihm hinein, sein Kopf schlägt gegen die Tischkante, bevor er endlich zu Boden sinkt. Es gibt keinen Raum zum Entkommen, aber auch keinen mehr um ihn noch weiter hindurch zu prügeln. Dieses Haus, das sein Vater mit seinen eigenen Händen gebaut hat, ist kaum elf Meter lang. Abgesehen von der Kochkammer und der Wohnstube gibt es nur noch den Schlafraum unter dem Dach, und einen angrenzenden Stall für das Pferd. Ein Toilettenhäuschen befindet sich draußen im Hof, am anderen Ende ihres kleinen Grundstücks, neben dem Steinwaschbecken, das seine Mutter sowohl zum Waschen der Lebensmittel als auch ihrer Kleidung benutzt. Als Kind hatte er einmal versucht, dort ein Huhn zu baden, und wurde mit einem Stock von ihr verjagt. Sein Vater türmt sich über ihm auf, seine Brust hebt und senkt sich wie ein asthmatisches Akkordeon. „Du wirst keinen Erfolg haben, verstehst du? Du wirst nicht gewinnen, ihr werdet versagen!“
„Wir brauchen keine Könige mehr, Babá, keine Diktatoren, wir brauchen Demokratie! Kapitalismus, ausländisches Geld, verstehst du? Babá, es ist vorbei!“
„Das werden wir noch sehen, nicht wahr?“ Plärrt der alte betrunkene Mann, eine desorientierte Abrissbirne, die über ihm hin und herschwingt. Als der Blick seines Vaters von ihm abwandert, sein betrunkener Körper leicht zur Seite kippt, nutzt er die Gelegenheit – ein sauberer, harter Stoß in seine Schulter, und er drängt sich durch, an seiner Mutter vorbei, die immer noch im Hintergrund wimmert, als er die Tür hinter sich zuschlägt.
Am folgenden Morgen verließ er Griechenland. In Deutschland war das Erste, was zu tun war, Arbeit zu finden und an die Universität zu kommen. Es schmerzte ihn, seine Mutter zurückzulassen. Er würde ihr bald Geld schicken.
—
Durch das Dröhnen ihrer Kopfhörer dringt ein angespanntes Stimmengewirr. Er klingt wütend. Sie wurden von der Polizei angehalten, einen Block von ihrer Haustür entfernt. Sie leben jetzt in einer guten Gegend. Für sie bedeutet das mehr Isolation in einem Haus, das zu groß ist, umgeben von deutschen Teenagern, die sie nicht zu mögen scheinen. Sie sitzt schläfrig auf dem beheizten Sitz des neuen, moosgrünen BMW ihres Vaters, dem neuesten Modell der 7er-Serie. Er hat das Fenster heruntergekurbelt. Der Polizist sagt etwas, ein Gemurmel, das sie durch die Musik ihres Discmans nicht versteht, aber ihren Vater hört sie laut und deutlich, wie er mit gepresster Stimme spricht. „Sie hätten mich sicherlich auch angehalten, wenn ich Deutscher gewesen wäre, nicht wahr?“
„Das hat nichts damit zu tun, Herr…Si..mi..“ Der hagere, bleiche Polizist schaut ausdruckslos durch das heruntergefahrene Autofenster. „Natürlich nicht, nicht wahr?“ Sie kann den
sonnenverbrannten Nacken ihres Vaters zucken sehen, eine Wölbung verspannter Muskeln wie die des riesigen tanzenden Bären, den sie einmal im Fernsehen gesehen hatte, einzig gehalten von einem winzigen Nasenring. Nachdem ihr Vater in ein Rohr gepustet hat, fahren sie schweigend weiter. Sie hat das Gefühl zu weinen, aber sie weiß nicht warum.
Das Haus ist nun schon eine Weile fertig. Es hat Jahre gedauert, bis die Möbel, die Wände, der Stuck an der Decke den Vorstellungen ihrer Eltern vollends entsprochen haben. Das Wohnzimmer ist eine mit weißem Marmorboden ausgelegte Halle, die sich zu einer sonnendurchfluteten Veranda öffnet. Es ist Mittag, hell und kalt, als er durch die Glastüren der Terrasse in das Wohnzimmer tritt. Hinter ihr stehend starrt er auf den Bildschirm, sieht sich an, was sie sieht, noch immer eine Gartenzange in der Hand. „Sie denken, sie sind keine Mörder, wegen ihrer sauberen Anzüge, nicht wahr?“ Auf dem orientalischen Teppich kniend hat sie den ganzen Nachmittag CNN geschaut. Für sie sind die einstürzenden Zwillingstürme das erste bedeutende politische Ereignis in ihrem jungen Leben. Sie dreht sich scharf zu ihm um. „Du weißt nicht alles, Papa! Die Deutschen sind gut; die Amerikaner auch! Sie wollen Frieden, Demokratie bringen!“ „Halt den Mund, was weißt du schon! Du bist ein verzogenes Kind in einem verrotteten Land.“ Sein verachtendes Grinsen durchdringt sie mehr als seine Worte. „Du halt mal den Mund!“ Als sie seinen Blick trifft, weiten sich ihre Augen, als sie realisiert, was sie gerade gesagt hat. Sie kennt die Zeichen mittlerweile gut – seine Pupillen weiten sich, seine Schultern spannen sich an, bereit zum Angriff. Sie versucht noch hinter das Sofa zu rennen, als er sie am Haar packt und über den gedeckten Glastisch schleudert. Sie landet auf allen Vieren in Scherben, kämpft darum, ihre zitternden Knie in Bewegung zu setzen. Er ragt über ihr auf, die Gartenzange in seiner Hand. Sie kauert sich zusammen. Zwischen Glastisch und Sofa eingeklemmt, greift sie panisch hinter sich, neben sich, sucht nach etwas, irgendetwas, bis ihre Finger schließlich auf einem großen Splitter der massiven Porzellanvase stoßen, die mit ihr vom Glastisch geflogen ist.
„Leg das weg!“, brüllt er. Sie holt tief Luft, holt aus, und schleudert sie ihm ins Gesicht. Ihre Knie noch weich und zittrig, rennt sie an ihm vorbei, im Hintergrund seine Schreie, hinaus auf die Terrasse, hinaus aus diesem Haus, aus diesem Leben.
—
Sie entdeckt ihn sofort. Im Rauschen des überfüllten Cafés sitzt er in einer Ecke, eine Zeitung in den Händen. Unter seinen breiten Schultern wirken seine Arme dünner, ebenso wie sein nun schwarz-weißes Haar. Sein sehniger Körper zeichnet sich immer noch durch den teuren, aber mittlerweile abgenutzten Sommermantel ab. Als er sie sieht, zucken seine Augen für einen kaum wahrnehmbaren Moment, sein Gesicht bleibt jedoch regungslos. Seit sie das Haus verloren haben, hat sie ihn nicht mehr gesehen.
„Ich verstehe immer noch nicht, was du da machst.“
„Es ist Amerikanistik, Babá. Es ist Literatur, Geschichte.“
„Du kannst du doch auch selber lesen, oder? Was ist mit Mathe, Medizin, Physik? Geld!“
„Nein, es ist nicht das gleiche, und ich hätte dann nicht so viel Zeit zum Lesen“, murmelt sie, enttäuscht über den Mangel an eigener Überzeugung. Mit zwei bis drei Studentenjobs pro Semester besucht sie kaum die Vorlesungen und wenn doch, dann meistens verkatert.
„Und was wirst du später sein? Eine Professorin?“ Sein Blick bleibt auf ihr haften, auch als sie die Augen senkt. „Nein, das glaube ich nicht.“
„Dann was?“
„Ich weiß es nicht.“
„Ich verstehe immer noch nicht.“
Er nimmt einen Schluck von seinem zweiten Bier. Seine Augen wirken rot, müde. Sie atmet in ihr unberührtes Weinglas, das sie vor ihrem Gesicht hält. „Ich bin jetzt politisch aktiv. In einer feministischen Gruppe.“
„Feministisch.“
„Ja.“
„Deine Mutter ist Ärztin, was willst du noch?“
„Es geht um Rechte und auch um Gewalt gegen Frauen.“
„Ich habe dich immer wie einen Jungen behandelt.“
„Ja, das habe ich gespürt.“ Ihr Blick ertrinkt im Weinglas.
Seine Finger sind nun verschränkt, sein Blick auf den Boden gerichtet. „Ich wünschte, du hättest es mir gesagt. Deiner Giagiá, ich habe ihr viel zu verdanken. Wir haben eine Weile bei ihr gewohnt, als ich noch Student war, frisch aus Griechenland kam, mit deiner Mamá, weißt du. Meine Eltern kamen ja nie nach Deutschland. Ich hätte mich von ihr verabschieden wollen. Ich wäre gekommen.“ Sie versucht ihn anzusehen, aber ihre Augen bleiben auf der überdekorierten Wand über seinem Kopf haften. Ein Schild sagt „Willkommen zu Hause“, ein anderes sieht das Glück der Welt in einer Kaffeetasse. Sie verengt ihren Blick. „Und was machst du jetzt?“
„Sie wollen mich für Bauarbeiten, aber ich habe ihnen gesagt, ich bin zu alt. Jetzt mache ich einen Test, um Sicherheitsmann zu werden. Die Nachtschichten zahlen gut.“ Sie nimmt einen Schluck aus der warmen Säure in ihrem Glas, die so riecht, wie sich ihr Magen anfühlt. Er starrt auf ihre Hände, die Ecken ihrer mandarinfarbenen Fingernägel sind schon lange abgesplittert. Sie nestelt an den Ärmeln ihrer Jacke herum, zieht sie über ihre Hände. Ein Piepen von seinem Nokia das auf den Tisch liegt, schneidet kurz die Stille. Er sieht hinüber, doch sein Blick ist fern. „Ich wäre gekommen.“
—
Er antwortet nicht, aber er muss da sein. Am Hochhaus hat sie schon auf die meisten Klingeln gedrückt. In diesen Vierteln öffnet niemand die Tür, es sei denn, man erwartet jemanden. Der Schnee fällt schwer auf ihre Augenlider, als sie nach oben schaut. Seine Lichter sind an. Er muss die Klingel gehört haben. Der Schnee schmilzt in ihre zu dünnen Schuhe. Ihre Beine geben bereits nach unter dem Gewicht ihres Bauchs, der sich ihr fast schon nach oben entgegendrückt. Sie schaut auf die Wetter-App. Heute Nacht wird es einen Schneesturm geben. Momentan fühlt sie sich mehr wie ein Fass implodierender Eingeweide als wie ein Mensch. Sie haben sie angerufen, weil er seit einer Woche nicht mehr in seiner Stammkneipe gesehen worden war. Sie hatte irgendwie gehofft, wenn sie sich nach all den Jahren wiedersehen würden, wäre es anders, er anders, sie vielleicht auch. „Möchten Sie reinkommen?“ Ein stämmiger Mann in seinen Dreißigern, vielleicht Polnisch, vielleicht Deutsch, Lebensmittel in der Hand, hält ihr die Tür auf. Sie bedankt sich und schreitet schwerfällig durch den verwitterten Eingangsbereich. Im zwölften Stock führt ein dunkler Teppich, der nach Knoblauch und Zigaretten riecht, zu seiner Wohnung, die fast am Ende des düsteren Korridors liegt. Sie tritt gegen die Tür, es spielt keine Rolle mehr. „Mach die Tür auf, Papa!“ Stille. Es ist unmöglich, das nicht zu hören. Bam bam bam. Ihr Fuß beginnt wehzutun. „Papa! Verdammt noch mal!“ Sie tritt fester, schlägt mit der Faust gegen die dünne Holztür, die nachzugeben beginnt. Eine heisere Stimme dringt von der anderen Seite herüber. „Bist du wahnsinnig? Geh weg!“
„Babá, jetzt sofort!“ Eine Frau lugt aus der benachbarten Tür, starrt sie unverhohlen an. Sie starrt zurück, was will sie denn, denkt sie sich, diese neugierige Kuh. „Mach die verdammte Tür auf,
Babá, oder ich rufe die Polizei!“ Ein Knarren hinter der Tür. Während sie dagegen hämmert, öffnet sie sich einen Spalt breit.
Sie drückt sich polternd hindurch, als sein Körper auf der anderen Seite nachgibt. Es dauert eine Sekunde, bis sich ihre Augen an das trübe Licht gewöhnt haben. Links in der Ecke ist eine kleine Küchenzeile zu erkennen, die die Hälfte des stickigen Raumes einnimmt. Ein schmales Bett in der rechten Ecke umfasst die andere Hälfte. Gelbliches Licht fällt ihr entgegen, das Leuchten einer Straßenlaterne, das durch das einzige Fenster im Raum dringt. Es beleuchtet den einfachen Holztisch mit zwei Stühlen, die in der Mitte des Raums stehen. Abgesehen von einer Pfanne mit Essensresten auf dem Herd und einigen benutzten Kaffeetassen, einer Zeitung und ein paar Stiften auf dem Tisch, ist der Raum spärlich eingerichtet, aber ordentlich. Ihr Atem beschlägt das Fensterglas, als sie nach unten starrt in die röhrende Menge, die hupenden Autos, während die Demonstranten im Schneesturm marschieren, wie jedes Wochenende jetzt. Als sie sich zu ihm zurückdreht, sind seine Brauen zusammengezogen, seine Augen glühend gelb und unbeweglich, während er immer noch wortlos an der Tür steht und ihren Bauch fixiert. „Was zum Teufel! Jeder dachte, du wärst tot!“ Es kostet sie ihren ganzen Atem, das zu sagen. Das Gewicht ihres Bauches erdrückt sie mehr und mehr. Sein Gesicht bleibt regungslos. Der dünne, billige Boden zittert unter seinen Schritten. Nach all den Jahren ist er immer noch mehr Muskel als Fleisch.
„Du bist jetzt also Kommunistin, ja?“
Sie runzelt die Stirn. „Tuscheln können die Griechen wirklich gut, stimmt’s? Ja, bin ich. Na, und.“
Er schmettert seine Hände flach auf den Tisch, sodass der schwankende Lampenschatten panisch über sein Gesicht tanzt. Seine Kiefermuskeln zucken, enthüllen einen Mund mit bereits fehlenden Zähnen. „Weißt du, was sie getan haben, Kind, weißt du das?“ Sie versucht den Blick auf ihn gerichtet zu halten. Mit dem Rücken zum Fenster und dem Tisch zwischen ihnen umklammert sie fest ihre Tasche, versucht sich darauf zu stützen. Wie eine Boje, die sich, statt im Boden des
Ozeans verankert zu sein, an schwingenden Seetang zu klammern versucht. Das Baby liegt schwer auf ihrem Zwerchfell, macht es ihr schwer zu atmen. „Nein. Du verstehst nichts, selbst nach all den Jahren nicht!“
„Und du musst wissen, was ihnen danach angetan wurde, oder?“, keucht er. Er packt die Tischkante, seine Knöchel weiß und kalt. Sein Gesicht ist rot, flehend, als er sich über die Tischplatte beugt. „So funktioniert die Welt nicht, Kind! Du wirst keinen Erfolg haben!“ Seine starrenden Augen haben jetzt ein wässriges Grau, sein Atem ist flach. Sie breitet die Arme aus, unterdrückt den stechenden Schmerz. „Oh, ich verstehe, und du weißt es besser, nicht wahr? Hier, in dieser glorreichen Wohnung! Du verstehst wie die Welt läuft, okay!“ Sein Gesicht verdunkelt sich, die Kaffeetasse zerschmettert rechts neben ihr an der Wand. Sie tritt näher, umklammert den Stuhl vor sich, ihr Atem unregelmäßig und schnell. Er presst die Zähne zusammen. Der Tisch quietscht unter seinem Gewicht, ihre Gesichter sind einen Atemzug voneinander entfernt.
„Kind, du verstehst das nicht. Du kannst das nicht gewinnen!“, bringt er mit gepresster Stimme hervor. Mit einem Griff an die Brust beugt er sich langsam nach vorne. Die Wut liegt schwer auf ihrem Gesicht, der Schmerz ist in seine verspannten Muskeln eingraviert. Die Last ist zu viel. Sie lehnt sich nach vorne, ihre Knie geben nach. Der Puls aus ihrem Bauch hämmert in ich rem Hals, rauscht in ihren Kopf, verschleiert ihre Sicht. Die Rufe draußen werden lauter, schriller, schlagen gegen die Hausfassade wie Blitze in Stein. Sie rutscht seitlich weg von dem Stuhl, auf den Boden. Ihr Vater, der immer noch die Kante des Tisches festhält, sinkt weiter herunter. „Du kannst das nicht gewinnen?“, keucht sie. „Das werden wir sehen, Babá.“ Ein schmerzverzerrtes Lächeln im Licht der Straßenlaterne. „Ja Kind, das werden wir sehen, nicht wahr?“
Von Penelope Kemekenidou, 20. März 25
Illustration von Katharina Schaaf