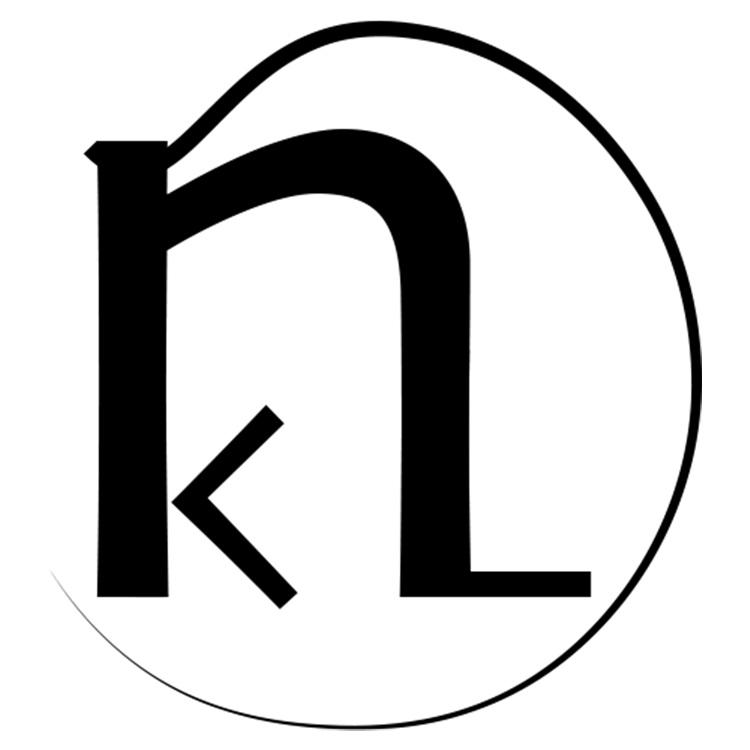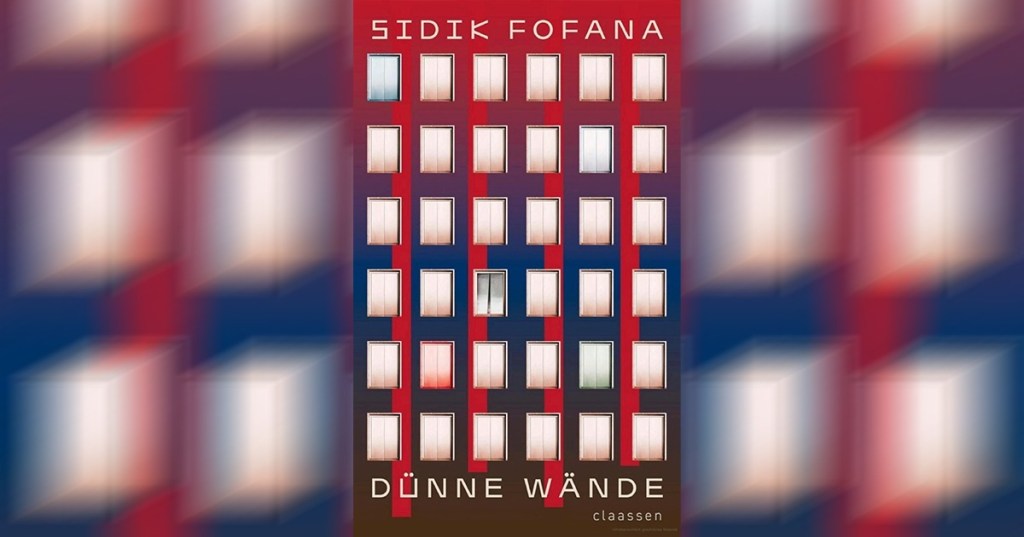Das Debüt „Dünne Wände“ von Sidik Fofana wurde 2022 auf Englisch unter dem Titel „Stories From the Tenants Downstairs” veröffentlicht und erschien im Sommer 2024 im Ullstein Verlag in der deutschen Übersetzung. In den USA wurde der Band von der Kritik gelobt und für mehrere Literaturpreise nominiert. Sidik Fofana ist Afroamerikaner und arbeitet als Lehrer in Brooklyn.
Wohnen im Kapitalismus
Sidik Fofana erzählt vom Wohnen im Kapitalismus, von einem System, in dem der intimste Raum – unser Zuhause – der Privatwirtschaft unterworfen ist und zum Gegenstand von Spekulation und Profitmaximierung wird.
Fofanas Buch spielt in der Wohnsiedlung Banneker Terrace in Harlem, einem Viertel, das von Gentrifizierung betroffen ist, wie viele andere in New York und weltweit. Seit den 2000er-Jahren wird das afroamerikanisch geprägte Harlem massiv umgestaltet. „Dünne Wände“ ist in einzelne Kapitel unterteilt, die als acht Kurzgeschichten für sich stehen können, sich aber durch ein unsichtbares Netz verbinden, das die Bewohner:innen miteinander verknüpft und das manchmal auch für sie sichtbar wird. Im Hausflur begegnet uns Mimi aus der 14D, eine alleinerziehende junge Mutter, die sich und ihren Sohn mit Kellnern und Haareflechten über Wasser hält, Swan, ihr Expartner, der nur wenige Stockwerke entfernt wohnt, sich nicht kümmert und noch bei seiner Mutter wohnt, die zwei Jobs hat, oder ihr schwuler Nachbar Dary, der mit dem Gedanken spielt, sich zu prostituieren. Fofana gibt unter anderem Einblick in die maroden und überforderten Schulen. Ein junger Lehrer möchte Shakespeare und Steinbeck mit den Schüler:innen lesen – Literatur, die ihnen völlig verschlossen bleibt, allein schon, weil sie selbst in der Mittelstufe Worte nicht korrekt dekodieren können.
Wie eine graue Wolke schwebt die drohende Verdrängung über den fragmentarischen Geschichten, die den Häuserblock wie einzelne Backsteine zusammensetzten: Die Immobilie wurde aufgekauft und die Hausverwaltung will die Mieter:innen loswerden. Schikanen, rückständige Renovierungsarbeiten, bewusst herbeigeführte unzumutbare Wohnverhältnisse oder schlicht die Erhöhung der Mieten zwingen die Bewohner:innen der Bannerker Terrace dazu, ihre Wohnungen aufzugeben.
Zwar gibt es eine Mieterinitiative, doch es gelingt ihr nicht, eine echte Gegenwehr zu organisieren. Die Bewohner:innen sind zu sehr mit ihrem Alltag beschäftigt, in dem es darum geht, die nächste Miete aufzutreiben. Ein Mädchen denkt: „Wie will man Menschen, die so komplett in ihrem Alltag gefangen sind, erklären, dass man was Großes vorhat.” und ein junger Mann fragt: „Weißt du, wie viele Menschen da draußen keinen Traum haben, für den sie leben? Sie putzen immer nur oder schleppen Kisten.”
Man kennt sich vom Sehen, hört einander durch die dünnen Wände, durch Türspalte und Schlüssellöcher, nimmt die anderen so in ihren intimsten Momenten wahr und begegnet sich doch möglichst diskret. Das Leben ist getaktet durch die Zahltage für die Miete. Die Zeitrechnung besteht für einige Bewohner:innen in Schichten und mehreren Jobs. In der Enge der Wohnverhältnisse versuchen die Menschen, ihre Würde zu verteidigen oder sie sich durch den Kauf von Statussymbolen anzueignen. Die Bewohner:innen jagen vergeblich dem amerikanischen Traum hinterher. Sie sind Überlebenskünstler, wenn es darum geht, die fehlenden 200 Dollar aufzutreiben. Dazwischen erleben sie Momente von Humor, Witz und Lebensfreude und auch das alltägliche Scheitern schafft Fofana mit Leichtigkeit zu beschreiben und erzeugt so komische Situationen. Immer wieder schimmert der Wunsch nach einem besseren Leben durch, die Hoffnung, es eines Tages aus der Misere zu schaffen. In Tagträumen malt man sich aus, wie es wäre, in ein schönes Haus in der Vorstadt zu ziehen oder wie das eigene kleine Geschäfte zu einer großen Kette werden würde. Die Belastung ist allgegenwärtig. Hilfsbereitschaft schlägt manchmal in Berechnung um, wenn der Druck der Hausverwaltung zu groß wird, wenn jeder Dollar zählt oder der drohende Rausschmiss einen in die Prostitution drängt. Doch die Tragik will kein Mitglied, sie spitzt sich in ihrer Komik zu.
Ein Mosaik aus Stimmen
Sprachlich eignet sich Fofana der Standardliteratur gegenüber, fremdes Gebiet an. Ungeniert und rücksichtslos schreibt er im Slang von Harlems Straßen, ohne sich literarischen oder ästhetischen Konventionen zu unterwerfen. Die Figuren denken und sprechen so, wie es die Menschen in diesen Vierteln tun. Fofana verschriftlicht das African-American Vernacular English, eine mündliche Varietät des Englischen, und auch in der deutschen Übersetzung gelingt es Jens Friebe den Ton zu bewahren, ohne, dass die Sprache hölzern oder aufgesetzt wirkt. Der Leser muss sich an den Klang gewöhnen, in einem Buch erwartet man keine umgangssprachlichen Schreibweisen, keinen rauen und direkten Ausdruck. Die Figuren sprechen, fluchen, murmeln und schweigen zwischen den Seiten. Sie sind höflich und zuvorkommend, patzig und frei heraus. Schon durch wenige Sätze schafft es Fofana in jeder Kurzgeschichte eine Stimme zur Sprache zu bringen, die lebendig wird. So lässt er Mimi die Verhältnisse so beschreiben: „”Manche leben von Kindergeld. Ihre Onkel sind im Gefängnis, ihre Tanten auf Crack, ihre Cousins in Gangs, ihre Schwestern auf dem Strich. Das sind die Geschichten, auf die alle geil sind. Der Scheiß, der vielleicht einmal im Jahr passiert. Da quatschen die niggas heut noch von, als wäre es gestern gewesen.” Er komponiert ein Spiel aus Stimmen, das trotz epischer Erzählform oft dramatische und rhythmische Elemente hat. Häufig verzichtet er auf Anführungszeichen, lässt die Sätze wie einen Gedankenstrom oder Sprechgesang fließen. Gesprochene Sprache wird hier zur Literatur – kraftvoll, zärtlich und ungeschönt. Sein Werk lässt sich in die Tradition der afroamerikanischen Literatur einordnen. Schriftsteller wie James Baldwin untersuchten schreibend die Straßen Harlems und dokumentierten Momente der rassistischen Unterdrückung und des Widerstands.
Der Prozess ohne Ausgang
Die Siedlung platzt aus allen Nähten vor Lebensdrang. Die Wut über die Verhältnisse entlädt sich oft unkontrolliert – gegen Lehrer, Vorgesetzte oder die Supermarktkassiererin. Man feierte die Wahl von Barack Obama, der erste Schwarze US-Präsident schürte die Hoffnung auf Veränderung. Der Stolz, dass ein Schwarzer im Weißen Haus sitzt, war groß, doch letztlich blieb Politik für die meisten Bewohner etwas, das „Leute wie sie“ nicht betreffe. Sie kennen die Welt der Macht nur als Ort des Ausschlusses und der Unterdrückung.
Es wird deutlich, dass alle Bewohner:innen unter dem gleichen Druck leiden. Wie dieser konkret charakterisiert wird und wer dahinter steht, bleibt in allen Geschichten diffus. Die Hausverwaltung tritt als übermächtiger und willkürlicher Bürokratie-Apparat auf, der nur durch eine an die Tür getackerte Mahnung, durch Papier und die Tinte der Zahlfristen in Erscheinung tritt, aber nicht als greifbarer Antagonist. Man wird an Kafkas Werke erinnert. Wie in „Der Prozess” bleibt das Individuum einer absurden Maschinerie ausgesetzt, die nach verborgenen Logiken handelt. Dabei arbeitet Fofana mit keiner konkreten Kapitalismusanalyse und auch seine Figuren verbleiben schließlich in ihrer Ohnmacht. Er lässt ihre Stimmen zu Wort kommen, sie treffen zwar aufeinander, aber bekommen keine Chance, kollektive Handlungsperspektiven zu entwickeln.
Fofana überzeugt in einem realistischen Duktus mit Geschichten, die auch von Millionen anderen US-Amerikaner:innen handeln könnten. Er zeigt die Schwierigkeiten eine tatsächliche Gegenwehr zu entwickeln.„Dünne Wände“ ist kein Appell, kein Elendsbericht. Es ist eine Provokation gegen die Verhältnisse und ihre Herrschenden.
Von Alina Essberger, 28. Februar 2025
Sidik Fofana „Dünne Wände“
Ins Deutsche übersetzt von Jens Friebe
Ullstein Verlag, 2024
256 Seiten, 23,00 Euro