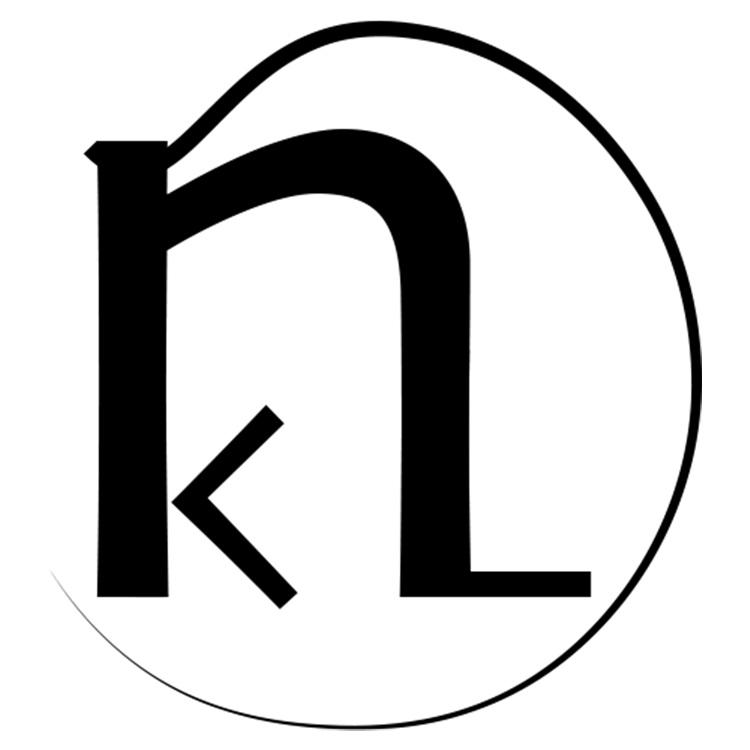Der Debütroman „So forsch, so furchtlos“, im Original „Panza de burro“, von Andrea Abreu ist 2022 in der deutschen Übersetzung von Christiane Quandt bei Kiepenheuer & Witsch erschienen. Im Juni 2024 wurde der Roman als Taschenbuch herausgegeben. Die spanische Autorin ist 1995 geboren und lebt auf Teneriffa. Neben ihrem Debüt, das 2020 bei Editorial Barrett erschienen ist und inzwischen in mehrere Sprachen übersetzt wurde, hat sie zwei Gedichtbände veröffentlicht. Außerdem sind Texte von ihr in verschiedenen Anthologien erschienen.
Geschichte einer Freundschaft, Geschichte eines Dorfs
Die Ich-Erzählerin und ihre beste Freundin Isora leben in einem Dorf auf Teneriffa. Dort verbringen sie den Sommer und haben ein Ziel: an den Strand zu gehen. Doch zu Fuß ist der Weg zu weit, und die Erwachsenen aus dem Dorf müssen arbeiten, müssen in den Hotels an der Küste oder in den Villen in den Bergen putzen, weil zu dieser Zeit die meisten Touristen kommen. Es ist eine andere Welt, in die man eintaucht, wenn man die Beschreibungen des Dorfs liest. Es ist nicht die Welt der Traumstrände und Sonnenuntergänge, nicht die der Resorts am Meer, auch nicht die der Urlauber mit Sonnenbrand.
Zum Meer schaffen es die beiden Mädchen nicht. Sie vertreiben sich den Sommer in der ländlichen Umgebung, stromern durch die Pinienwälder und hängen ihre Füße in den Kanal, der in einem Betonbett fließt. Sie spielen Spiele, die Kinder eben spielen, mit Puppen, tun so, als wären sie Rettungsschwimmer in einem aufblasbaren Pool, aber eine Barbiepuppe ist schwanger von einem Unbekannten, weil sie mit so vielen Männern schläft, und die Ertrinkende steht auf den Rettungsschwimmer. Sie sind in einem Alter der Umbrüche, in dem kindliche Rituale und Spielerein ihre vermeintliche Unschuld verlieren. Dieses Alter und das Erwachen des inneren Vulkans nimmt Abreu in den Fokus.
Der Vulkan als Vorbote
Über dem kanarischen Dorf thront der Vulkan in den Bergen. Ein Symbol für den Ausbruch, den Kontrollverlust, für vorzeitliche Urkräfte, das Erwachen dieser Kräfte, aber auch für den Tod. „Er ist wie eine Art Verkündigung der Fatalität des Lebens. Wenn man in seiner Nähe lebt, denkt man nicht ständig daran, dass man sterben wird, aber es kommt vor, dass es einem in den Sinn kommt, dass es explodieren könnte. Es ist die ständige Präsenz des Todes, schön und schrecklich zugleich“, meint die Autorin in einem Interview mit dem Magazin Condé Nast Traveler. Diese Zerrissenheit steckt auch in den Beschreibungen der kanarischen Landschaft, der Häuser im Dorf, der ländlichen Umgebung und der Menschen, die mit ihr verwachsen sind. Spannend ist die Verschiedenheit der beiden Freundinnen: Isora ist stämmig, kurvig und laut, die Erzählerin klein, dünn und folgt den Anweisungen der Freundin, die zum Beispiel entscheidet, wohin sie gehen, was sie spielen, die ihr Wege an Orte zeigt, zu denen sich die Erzählerin nicht allein traut. Schließlich geraten sie in einen Streit, der eindrücklich die Tragweite transportiert, die ein Streit mit der besten Freundin für ein junges Mädchen bedeutet. Man könnte Isora als Kind des Vulkans bezeichnen, sie ist aufbrausend, schamlos, bricht mit Konventionen und ist der Star der Erzählung. Dagegen wirkt die Erzählerin wesentlich blasser, steht im Schatten der starken Persönlichkeit ihrer Freundin, beneidet sie darum, dass ihr schon Brüste wachsen und dass sie immer die richtigen Worte findet. Isora will sich nicht so ganz fügen, rebelliert gegen die Großmutter, bei der sie aufwächst, ist hungrig auf das Leben und immer zu einer Schandtat bereit.
Der Widerspruch zwischen dem Tod und dem Heranwachsen der Mädchen, zwischen dem Ausbruch des Vulkans als Sturz in die Tiefe oder Ebnung für Neues, die Verknüpfung von Kindlichkeit mit Vergänglichkeit, das sind produktive Widersprüche, weil sie das Schöne mit dem Schrecklichen in ein notwendiges Verhältnis setzen. So gehört die Erkenntnis darüber, dass man als Mensch einmal sterben wird, zu den grundlegenden Erfahrungen, mit denen ein Kind in seiner Entwicklung konfrontiert ist. Dieses Gefühl, die kindliche Angst vor dem Tod verbunden mit dem forschen Drang, etwas Neues zu entdecken, sorgt für eine bedrückende, aufbrausende, aber auch unbeschwerte Stimmung. Diese Mischung ist für den Roman charakteristisch.
Trotz der kindlichen Beschreibungen und dem verspielten Umgang mit Sprache blitzt immer wieder eine Schwere auf. Wenn die abgemagerten Straßenköter um Essen betteln, die alten Frauen im Dorf kaum Geld für frische Lebensmittel haben, wenn an die früh verstorbene Mutter von Isora erinnert wird. Dabei gibt es teils Ähnlichkeiten zur pikarischen Erzählweise, die vielen spanischen Autoren wie Cervantes eigen ist, ebenfalls ist der Roman episodisch strukturiert.
Die Schwere ist vielleicht die ständige Präsenz des Todes, von der die Autorin spricht und die sich im Symbol des Vulkans niederschlägt, der in einem Gedankenexperiment ausbricht und die Menschen von der Insel vertreibt. Dieser Widerspruch zwischen Leben und Tod, zwischen dem Erwachen der eigenen Lust, der Sexualität und der Umkehr dieser Lust in Ekel und Gewalt ist das Feuer, das dem Debütroman von Andrea Abreu Leben einhaucht.
Zuweilen wünscht man sich in den teils arg kindlichen Szenarien jedoch etwas mehr von dieser Schwere. Es gibt kein Element, keine Figur, die das kindliche oder heranwachsende Bewusstsein überschreitet. Die Beschreibungen kippen immer wieder ins Infantile, wodurch teils eine Beliebigkeit und auch Belanglosigkeit solcher Passagen entsteht. Dadurch verlieren auch tragische Ereignisse etwas von ihrer Tragweite und werden eher als fantastische statt als realistische Momente wahrgenommen.
Realismus als Anspruch
Abreus Sprache ist direkt, nimmt kein Blatt vor den Mund, ist mutig, wenn es darum geht, Worte zu erfinden, und szenisch, wenn sie ein Geräusch wiedergeben will. „Ich wollte eine realistische Geschichte erzählen, also musste auch die Sprache realistisch sein“, so Abreu in demselben Interview. Es gibt keine Metaphysik, die Sprache des Romans ist körperlich, verliert sich nicht in kontemplativen Ausführungen, sondern befindet sich mitten im Leben der beiden Freundinnen. Dabei ist sie gleichzeitig verspielt, durchtrieben und nimmt nichts heilig. Nicht einmal die Unterwäsche der toten Mutter, die als Projektionsfläche für jugendliche Fantasien benutzt wird.
Mit dieser Sprache schafft es die Autorin, realistisch die Gefühle und Widersprüche heranwachsender Mädchen zu beschreiben, die ihre eigene Sexualität entdecken. Aber auch, die Lebensrealität der Menschen zu zeigen, die das ganze Jahr über auf der Insel leben, eine Realität, die diese Menschen in- und auswendig kennen, die jedoch im Schatten einer Vorstellung von außen steht, die nichts mit dem Leben im Dorf zu tun hat. Dazu gehört auch, dass typische Wendungen und Begriffe aus dem Dialekt verwendet werden, der auf den kanarischen Inseln gesprochen wird.
Der Originaltitel auf Spanisch „Panza de burro“ (wörtlich: „Rücken eines Esels“) ist ein Begriff für ein typisches Wetterphänomen, das man auf den kanarischen Inseln erlebt. Es beschreibt die Ansammlung einer Wolkendecke auf niedriger Höhe, die von oben wie ein Eselsrücken aussehen soll und die zwar die Sonne abmildert, jedoch für eine starke Hitze und ein Druckgefühl sorgt. Die teils bedrückende Atmosphäre, die Grenze, die für die beiden Mädchen in der Grenze des Dorfs besteht, innerhalb der sich das Gefühl von Hitze staut, innerhalb der ihre Sexualität erwacht – der Originaltitel des Buchs ist eine gelungene Metapher für die Situation der Freundinnen in dem heißen Sommer oben auf den Bergen.
Von Svenja Hauerstein, 29. Januar 2025
Andrea Abreu, „So forsch, so furchtlos“
Ins Deutsche übersetzt von Christiane Quandt
Kiepenheuer & Witsch, 2024
192 Seiten, 13,00 Euro