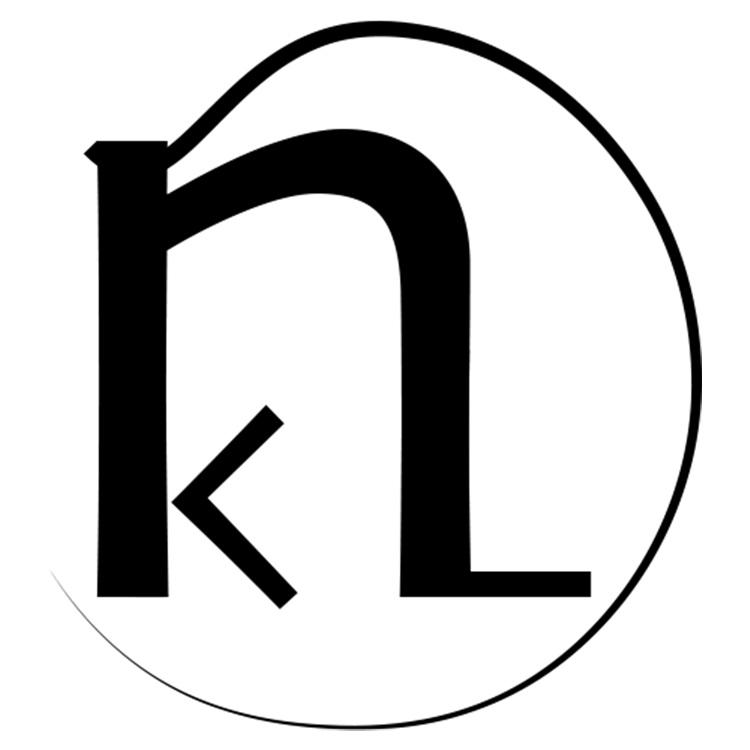In „Schellenmann“ lässt Philipp Böhm das Bedürfnis seines Protagonisten, nicht allein zu sein, auf einen Ort treffen, der fast grotesk trostlos ist. Ein sprachgewandtes Debüt, das mit sorgfältig gezeichneten Charakteren überzeugt, inhaltlich die trostlosen Verhältnisse aber allzu starr erscheinen lässt.
Eine mysteriöse Figur, an der sich Gedanken abarbeiten lassen
Kaum verwunderlich, dass Jakob sich wünscht, keine Vergangenheit und keine Geschichte zu haben. In der Schule ausgegrenzt, von der ersten Liebe enttäuscht und von seinen „Freunden“ martialischen Streichen ausgesetzt, hofft er mit 14 jeden Tag auf einen bewölkten Himmel, der ihn nicht dazu zwingt, den Tag draußen zu verbringen. Er beginnt die Jahre zusammenzurechnen, bis er endlich die Stadt verlassen kann, will einfach nur die Augen schließen und abwarten, bis die Jugend vorbei ist. Doch die Zeit vergeht nicht schneller. Er ist an keinem anderen Ort, als er die Augen aufmacht. Er ist immer noch in der gleichen belastenden Zeit am gleichen belastenden Ort wie vorher, nur eins hat sich geändert: Er sieht den Schellenmann.
Der Schellenmann ist ein Produkt von Jakobs Geist, eine große Gestalt im Fastnachtskostüm mit klirrenden Schellen daran. Warum produziert Jakobs Geist den Schellenmann? Sicher lässt sich nur sagen, dass es etwas mit Angst und mit Einsamkeit zu tun hat. Jakob sieht die Gestalt, wenn er sich allein und nicht sicher fühlt. Dramaturgisch hat der Schellenmann etwas von einem Trick. Die Geschichte würde auch ohne ihn funktionieren, er gibt ihr keine bedeutende Wendung und fügt sich in die Grundatmosphäre ein, anstatt sie zu prägen. Gleichzeitig ist er ein Element, das Neugier weckt und Spannung erzeugt – ohne diese Neugier zu befriedigen oder die Spannung durch eine wirkliche Erklärung aufzulösen. An der Nase herumgeführt fühlt man sich als Leser am Ende jedoch nicht, gerade weil es nicht um den Schellenmann geht. Oder anders gesagt: In einer schlechten Geschichte hätte diese mysteriöse Figur wie ein billiger Versuch gewirkt, sie künstlich aufzuwerten. In einer guten Geschichte ist er ein Element, an dem sich die Gedanken über die Geschichte abarbeiten lassen – aber nicht müssen.
Ein unverständlicher Wunsch
In der Gegenwart arbeitet der 19-jährige Jakob in einer Textilfabrik am Rand der Kleinstadt, in der er aufgewachsen ist. Rückblenden in die vergangenen fünf Jahre machen seinen Charakter vor allem in der ersten Hälfte des Buchs für den Leser greifbar, wobei es nicht immer einfach ist, zu erkennen, in welchem Jahr die Szene stattfindet. Der wesentliche Handlungsstrang entfaltet sich entlang der Frage, ob und warum Jakob in dem Ort und in der Fabrik bleibt. Doch nicht nur für ihn stellt sich diese Frage, sondern auch für seinen besten Freund Hartmann, der ihm dem Job besorgt hat und für Jakob eine Art Retter war. Während Hartmann allerdings, wie alle anderen, weg will, will Jakob bleiben – und das, obwohl sich Böhm alle Mühe gibt, diesen Wunsch so unverständlich wie möglich erscheinen zu lassen.
Die Fabrik ist ein fast schon lebensfeindlicher Ort. Permanenter Staub und Textilflusen in der Luft machen krank, die Arbeit ist belanglos, die Gespräche mit den Kollegen sind inhaltsleer, der Chef ist ein Choleriker, im Bach vor der Fabrik schwimmen tote Tiere und Müll, auf den Feldern davor sterben die Kühe. Alle wollen weg. Böhm stellt hier die Frage, wie schlecht eine Struktur sein muss, damit sie einem verzweifelt nach Struktur Suchenden nicht mehr als „kleineres Übel“ erscheint. Dabei will Jakob nicht bleiben, weil er das Geld braucht, es ist allein der soziale Gehalt der Arbeit, der Jakob dazu bringt, sich an den Ort seiner Ausbeutung zu klammern. Es ist für ihn „ein Platz“, ein Ort, der seinen Tag in Abschnitte zerteilt, der ihn nicht an seiner Einsamkeit und dem „Klang der Schellen“ verzweifeln lässt. Sich ausgerechnet an einen solchen Ort zu flüchten, erscheint genauso tragisch wie grotesk. Dass diese Konstellation viel Raum für schwarzen Humor und bittere Ironie bietet, weiß Böhm regelmäßig gekonnt auszunutzen. Neben diesen Elementen versucht der Autor, die Schwere der Thematik vor allem mit Skurrilität abzufedern, die sich gleichermaßen durch Dialoge und Charaktere zieht. Das macht „Schellenmann“ zwar leichter verdaulich und unterhaltsam, es verhindert aber auch, dass sich die Tragik in Wut verwandelt, das Unverständnis in Handlungsdrang.
Glaubst du, dass man so leben kann?
Auch wenn man merkt, dass die Fabrik im Mittelpunkt der Szenerie steht, ist die Handlung nicht eindimensional auf sie ausgerichtet. Seien es Jakobs Kindheitstraumata, seine Freundschaft mit Hartmann oder seine etwas merkwürdige Beziehung zur Freundin eines Arbeitskollegen: Böhm erweckt nicht den Eindruck, die Geschichte „um die Fabrik herum“ geschrieben zu haben, auch die anderen Handlungslinien sind sorgfältig gezeichnet und hinterlassen eigene Eindrücke. Die detailliert und authentisch herausgearbeiteten Nebenfiguren versorgen die Geschichte regelmäßig mit neuen Aspekten, ohne die sie wohl nicht die nötige dramaturgische Energie entwickeln könnte. Dennoch verliert sich die Handlung nach dem gelungenen Aufbau der Charaktere und der Schaffung einer eindrücklichen Atmosphäre spätestens im letzten Drittel etwas in Szenen, die die Geschichte kaum fortentwickeln.
Durch Hartmanns Mund fragt Böhm den Leser an einer Stelle: „Glaubst du, dass man so leben kann?“. Eine in unserer heutigen Gesellschaft mehr als berechtigte und notwendige Frage. Der Autor liefert jede Menge Argumente dafür, warum die Antwort „nein“ lauten muss. Doch was folgt daraus? Dass die Arbeitenden auch über Macht verfügen, dass nicht nur Flucht oder Anpassung, sondern auch Veränderung eine reale Handlungsoption darstellt – dies zu erkennen, legt Böhm in die Verantwortung seiner Leserschaft. Er selbst macht mehr als deutlich: dieser Ort wird sich nicht ändern, er ist ein Faktum. Sinnbildlich liegen dort, wo die Arbeiter der Fabrik Pause machen, „Gewerkschafszeitungen, die niemanden interessieren“. Manchmal sabotiert ein Kollege die Anlage, um früher Schluss machen zu können, manchmal bedient Jakob die Maschine absichtlich falsch, damit sie „verreckt“. Doch der Protest bleibt individuell, spontan und ziellos. Verändern will niemand etwas, getreu dem Credo von Jakob: „Es gibt kein System“. Dass die dargestellten Verhältnisse durchaus System haben, scheint zwar in der Handlung durch, aber die konsequente Nicht-Darstellung der Veränderbarkeit dieser Verhältnisse macht „Schellenmann“ letztlich zu einer Momentaufnahme, die das Negative zu sehr akzentuiert. Unter der Voraussetzung, dass alle weg wollen, ist das sicher passend. Aber es wollen eben nicht alle weg.
Von Daniel Polzin, 30. September 2024
Philipp Böhm, „Schellenmann“
Verbrecher Verlag, Berlin 2019
224 Seiten, 20,00 €