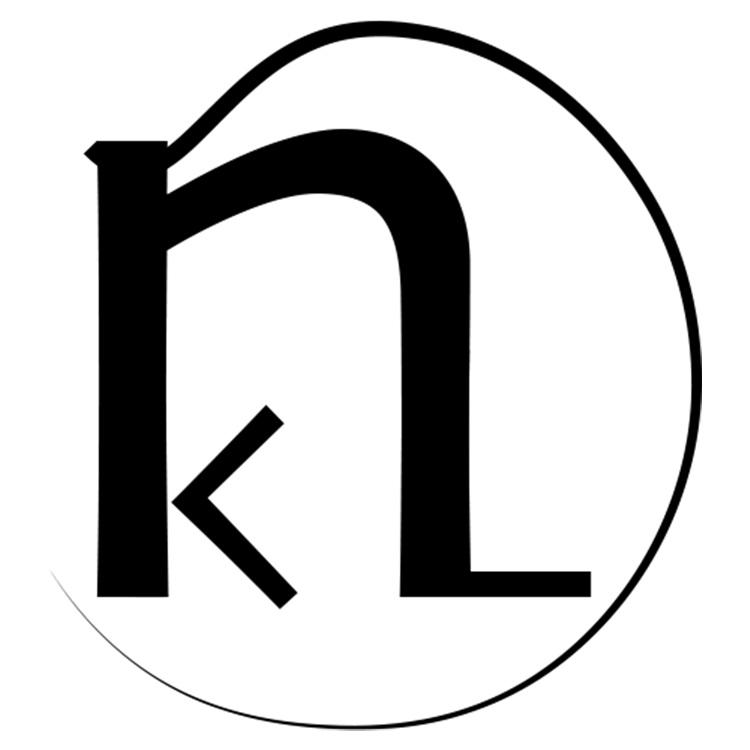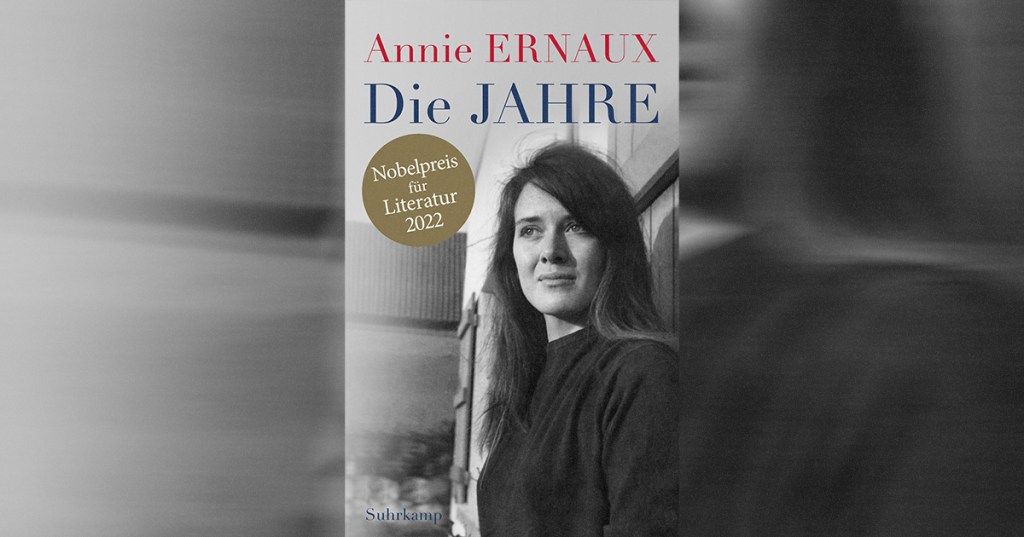Im Jahr 2008 erschien „Die Jahre“ und wurde 2017 ins Deutsche übersetzt. Die Trägerin des Literaturnobelpreises Annie Ernaux schildert in dieser „unpersönlichen“ Biografie die Jahre von ihrer Geburt 1940 bis zur Jahrhundertwende in einer neuartigen, romanfremden Erzählstimme und -zeit. Sie geht dokumentarisch vor, verwendet Quellen der Zeitgeschichte wie Schlagzeilen und Liedveröffentlichungen. Aber auch mit privaten Fotografien und intimen Erinnerungen widmet sie sich den Bewegungen, Widersprüchen und Formen, die eine Gesellschaft und das ganze Leben eines jungen Mädchens, einer jungen Frau oder alternden Mutter annehmen kann. Sie ordnet den Text wie eine Collage aus Zeitungsausschnitten, vergilbten Fotografien, Tagebucheinträgen und Filmstreifen. Sie findet einen Takt, der dem Leben entspricht. Die Jahre großer Ereignisse und die der Gewohnheit und Stille. Der Text kann, ohne die bekannten Werke Ernauxs zu kennen, auf den Leser auch überfordernd wirken. Denn in diesen offenbart sie Stück für Stück Teile ihres Lebens, auf die man beim Lesen von die Jahre Bezug nehmen kann. Das collagenartige Dokumentieren ist seiner Form nach eine bis dahin unbekannte Ästhetik.
Der Blick und die Geschichte einer jungen Frau als individuelles Erlebnis fließen in das Bewusstsein aller jungen Frauen, noch heute. Oder von Müttern, Arbeiterkindern, als kollektive Erfahrung der Welt. Selbst hält sie in „die Jahre“ fest: „[F]indet das Schreiben hier etwas wieder, kann es einfangen, welches Bild die kollektive Geschichte auf die Leinwand des individuellen Gedächtnisses projiziert hat.“
Annie Ernaux stammt aus einer französischen Arbeiterfamilie und setzt sich in all ihren Romanen, die autobiografische Einschläge haben, mit ihrer sozialen Realität und dem Eintreten in eine andere werktätige Schicht auseinander. Der Drang nach dem Schreiben packt sie als junge Frau noch vor dem Literaturstudium, verlässt sich jedoch für ein ganzes Jahrzehnt.
Etwas von der Zeit retten, in der man nie wieder sein wird
In ihrer Erzählung thematisiert sie die Nachkriegsjahre ihrer Kindheit und die tiefen Kerben, die der Krieg in ganze Familien schlug, das Eintreten in die sogenannte Konsumgesellschaft, wenn sie schreibt: „Der Fortschritt steckte im Plastik und im Resopal, in Antibiotika, in der Krankenversicherung, im fließenden Wasser und in der Kanalisation, in Ferienlagern und höherer Bildung, im Atom.“
Oder das erste Mal Lust und Verlangen, Masturbation als Tabu, die Algerienkrise, das Eintreten in ein intellektuelles Umfeld an der Universität und das Fremdfühlen, 1968, die Scham, der Kampf um Abtreibung, die Einsamkeit einer Ehe, ein global um sich greifender Kapitalismus, das eigene Altern und Krankheit, das Nichtschreiben und der Drang zum Schreiben, nicht eingelöste Versprechungen an sich selbst, das Frausein, das Muttersein. Mit all diesen Themen beschreibt sie den Kontakt und die Widerspiegelung des Ichs zur Gesellschaft, zum Menschen und zu den Verhältnissen. Und die Schärfe der Widersprüche, der Umbrüche und die Starrheit dieser Verhältnisse.
Dabei schlägt sie keinen überheblichen, wenn aber stellenweise ironischen Tonfall über die französische „Mehrheitsgesellschaft“ oder die „kleinen Leute“ und das „selbstschaffende Bildungsbürgertum“ an. Mit zynischen Kniffen, aber auch Sanftheit und Großmütigkeit, beschreibt sie die zuweilen absurden und brutalen Windungen in der Medien- und Kulturöffentlichkeit sowie Politik, aber auch der kleinsten Einheit der Welt, dem Selbst. Das unmerkliche Hineinwachsen in eine Gesellschaftsformation, gegen die Ernaux als überzeugte Sozialistin eigentlich aufbegehrt und deren Widerspruch man am eigenen Körper spürte, nicht im übertragenen Sinn, wenn Annie Ernaux von Schmerz und der Brutalität einer illegalen Abtreibung schreibt. Das Schreiben ist Ernaux als Retter begegnet. Aus der Enge einer Ehe heißt es in „Die Jahre“:
„Wenn sie Zeit mit ihrer Familie verbringt, fühlt sie nur und denkt nicht. Richtige Gedanken kommen ihr nur, wenn sie allein ist, […] Gedanken über sich selbst, über das, was sie hat und was sie ist, über ihr Leben. […] In ihrem Tagebuch, das sie nur noch selten aufschlägt, ganz so, als würde es eine Bedrohung für den Zusammenhalt der Familie darstellen, als hätte sie kein Recht auf ein Innenleben, notiert sie: ‚Mir fällt gar nichts mehr ein. Ich versuche nicht mehr, mir mein Leben zu erklären‘ und: ‚Ich bin zu einer arrivierten Kleinbürgerin geworden.“
In einem Interview betont sie, dass gerade im Schreibprozess zu „Die Jahre“ die klare Abgrenzung und Unterscheidung von Fiktion und Wirklichkeit keinen Sinn mehr für sie hatte. Ihre Beschreibungen speisen aus Gefühlen, die sie noch heute spüre.
Dabei bleibt sie in ihren Beschreibungen stets in der dritten Person ohne figürlichen Bezug. Es wird vage von „man“ oder „sich“ gesprochen. Das erzeugt eine Fremde und Beliebigkeit des epischen Ichs. Vielleicht wäre episches Kollektiv hier treffender.
Worte wie Messer, bis in den Körper
Das Schreiben als Drang, sich der Wahrheit zu nähern, sich am Gefühl der Scham und an historischen und soziologischen Daten zu bedienen, führt Ernaux zum Anspruch an ihr eigenes Schaffen: „Schreiben, so scharf wie ein Messer“.
Da sie es erlebt habe, existiere es, sei nichts Schamvolles und sei notwendig aufgeschrieben zu werden. Das Nichtschreiben sei ein moralischer Fehler.
In „Die Jahre“ gelingt es ihr auch ohne den brutal ehrlichen Bezug zu ihrer Person, das Schreiben und Lesen nicht zu einer verträumten und privaten Tätigkeit zu machen, sondern zum realen Eingriff in das Leben und die Verhältnisse, in dem sie diese offenlegt. Ihre Worte sollen bis zum Körper reichen und diesen bewegen, auch wenn sie Enge, Entsetzten oder Betretenheit erzeugen. Ernaux reagiert mit ihrer Sprache auf die unübersichtlicher werdenden Verhältnisse der Welt nicht mit ästhetisch aufbereitetem Eskapismus. Das Besinnen auf Klassenherkunft, das Erkennen der Verhältnisse, ist das Programm ihrer Literatur.
In einem Interview betont Ernaux, dass es nicht der Mut sei, der sie zum Schreiben bringe, sondern das Verlangen danach, Orte und Dinge aufzusuchen, die bisher noch nicht untersucht oder erkundet wurden.
In „die Jahre“ erzählt sie von der Vergänglichkeit der Erinnerung: „Auch werden sich auf einen Schlag alle Wörter auflösen mit denen man Dinge, Gesichter, Handlungen und Gefühle benannte, mit denen man Ordnung in die Welt gebracht hat, die das Herz höherschlagen […] ließen.“
„Etwas von der Zeit retten, in der man nie wieder sein wird.“ schreibt Annie Ernaux in ihrem letzten Satz. Sie hat etwas gerettet und festgehalten, das allgemeiner ist als die Erfahrung oder Zeit, aus der sie speisen kann.
Was sie beschreibt, trifft nicht nur auf eine konkrete Generation oder auf den französischen Leser zu. Auch wenn sie aus einer historischen, subjektiven Erfahrung und erfassbaren soziologischen Daten speist, schafft sie es in „die Jahre“ Aussagen zu treffen, die sehr viel weiter gehen. Sie rettet eben nicht nur etwas aus der Zeit, in der sie nie wieder sein wird, sondern auch aus jener, in der sie auch zukünftig niemals sein wird.
Alina Essberger, 30 März 2024
Annie Ernaux „Die Jahre“
Suhrkamp Verlag, Berlin 2017
Hardcover, 256 Seiten, 22 €